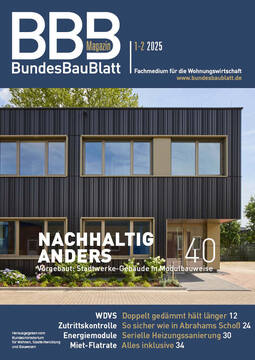Saugstarkes Oxford: Ein Quartier als Schwamm
Hydraulischer Überlastung vorbeugen, gegen Starkregen und Hitze gewappnet sein, Naherholungsgebiete schaffen: Das Oxford-Quartier in Münster nutzt Regenwasser als Ressource und schafft einen naturnahen Wasserkreislauf. Die Quartiersentwicklung zeigt, wie Stadtgestaltung mit Klimaanpassungen und Gewässerschutz verbunden werden können.
Man kann ihn mögen oder nicht, Regen ist ambivalent – nicht nur in der persönlichen Wahrnehmung. Als Wasserspender ist er für Menschen, Tiere, Landwirtschaft und Grünflächen essenziell wichtig, doch in großen Mengen entfaltet er zerstörerische Kräfte. In Münster ist Regenwetter beinahe Teil der städtischen Identität, während man sich gleichzeitig noch mit Schrecken an die Überschwemmungen im Sommer 2014 erinnert, als eine urbane Sturzflut tausende Keller mit Wasser volllaufen ließ. Laut Sonja Kramer aus der Abteilung Planung Wasserwirtschaft der Stadt Münster sind es Ereignisse wie diese, die die Stadtplanung zum Umdenken zwingt: „Die Stadt muss sich in den kommenden Jahrzehnten als Folge des Klimawandels auf eine größere Zahl an Starkregenereignissen und Hitzeperioden einstellen.“
Entschleunigung für Flüsse
In der Vergangenheit basierten urbane Wasserkonzepte vorrangig darauf, Niederschlag so schnell wie möglich von den vielen versiegelten Flächen abzuleiten. So schnell wie möglich hieß auch eine Begradigung der Flüsse, um deren Fließgeschwindigkeit zu erhöhen. Heute sehnen sich viele aus ästhetischen und ökologischen Gründen nach grüneren Innenstädten. Aber auch die Folgen von Starkregenereignissen sprechen gegen die alte Denkweise: Große Wassermengen überlasten Kanäle und Flüsse, daraus resultierende Hochwasser haben verheerende Auswirkungen auf die gebaute Umwelt und natürliche Lebensräume in und um die Gewässer. Ein besseres Wassermanagement braucht also vor allem eins: Entschleunigung.
Regengärten und offene Rinnen
„Um die Flächenperformance von Quartieren vor diesem Hintergrund optimal zu gestalten, müssen alle Fachdisziplinen – Stadtplanung, Wasserwirtschaft, Freiraum- und Verkehrsplanung – einen integralen Planungsansatz wählen und gemeinsam den Entwurf prägen und ausgestalten“, betont Kramer. Der Masterplan des Oxford-Quartiers sieht auf allen Baufeldern Retentionsmulden vor, die das Entwässerungssystem vor Überlastung schützen sollen. Der städtebauliche Entwurf aus der Feder des Berliner Architekten Diébédo Francis Kéré wurde in Zusammenarbeit des Büros Kéré Architecture mit Schultz-Granberg Städtebau+Architektur und bbz landschaftsarchitekten sowie dem Wasserbauingenieur Prof. Mathias Uhl aus Münster finalisiert. Entsprechend der interdisziplinären Zusammenarbeit erfüllen die Retentionsmulden gleich mehrere Zwecke: Bei Regen sammelt sich Wasser in den Mulden, verdunstet dort oder wird nach und nach verzögert abgeleitet. An den Stellen entstehen in Folge attraktive Regengärten und natürliche Feuchtbiotope mitten im Quartier.
Zusammen mit den oberflächennahen offenen Rinnen zieht sich Wasser so als gestalterisches Element durch das gesamte Quartier. Zunehmende Extremwetterereignisse bedeuten auch, dass über mehrere Tage anhaltende Hitzeperioden mit Temperaturen über 30 °C gehäuft auftreten. Das verdunstende Wasser übernimmt an heißen Sommertagen also auch eine kühlende Funktion. Dabei unterstützen die geringe Oberflächenversiegelung und viel Grün.
Prinzip Schwammstadt
Das 26 Hektar große Gebiet wurde bis 2013 als Kaserne des britischen Militärs genutzt, 2019 startete die Konversion in ein Wohnquartier für rund 3.000 Bewohnende, 2030 ist die Fertigstellung geplant. Die alten Fundamente geben jetzt den Baugrund für den Neubau vor. Auf diese Weise werden möglichst wenig neue Freiräume versiegelt. Durch den Abbruch weitläufiger Pflaster- und Asphaltflächen konnte die Bodenversiegelung um rund vier Hektar reduziert werden. Aus Kasernenzeiten können aber nicht nur große Teile der Gebäudestruktur übernommen
werden, sondern auch mehr als 170 Jahrzehnte alte Bäume, die Schatten spenden und wie eine natürliche Klimaanlage wirken. Ergänzt werden sie mit über 300 Neupflanzungen auf den Grün- und Parkanlagen, die rund ein Drittel der Gesamtfläche bilden.
Zusätzlich zu den öffentlichen Flächen müssen auch die privaten Bauherren nachweisen, dass das Regenwasser weitestgehend auf ihren jeweiligen Grundstücken in Mulden, Zisternen oder Versickerungsanlagen zurückgehalten wird. Es dürfen lediglich drei Liter Regenwasser pro Sekunde und Hektar in das öffentliche Netz eingeleitet werden. Zur besseren Versickerung von Oberflächenwasser trägt die Verwendung von offenporigen Belägen bei. So entsteht ein Quartier nach dem Prinzip Schwammstadt: Die Flächen sind in der Lage, große Mengen an Wasser aufzunehmen und zeitverzögert wieder abzugeben.
Regenrückhaltebecken und Retentionsbodenfilter
Alle öffentlichen Entwässerungsleitungen fließen schließlich zum Regenrückhaltebecken, das als idyllische Wiese östlich des Quartiers liegt. Von dort gelangt das Wasser in den Gievenbach, der wiederum ein Zufluss des städtischen Aasees ist. Wasser, das von den Hauptverkehrsachsen abfließt, kann mit Ölresten und Reifenabrieb belastet sein und überströmt daher zunächst einen Retentionsbodenfilter. Dieser hält Verschmutzungen zurück und das gereinigte Wasser gelangt unterirdisch über Drainageleitungen in den Bachlauf. Schilfpflanzen auf dem Bodenfilter haben einen zusätzlichen Reinigungs- und Verdunstungseffekt.
Der Weg des Wassers
Die Errichtung des Regenrückhaltebeckens war Anlass für eine weitere ökologische Maßnahme der Stadt Münster: Man gab dem Wasser des begradigten Gievenbachs seinen historischen Raum zurück. Denn allgemein gilt: Je natürlicher ein Gewässer, desto besser ist seine Selbstreinigung. In natürlichen Flüssen fördert eine Vielzahl von Strömungsmustern den Austausch von Sauerstoff und sorgt dafür, dass organische Stoffe besser durch Mikroorganismen abgebaut werden können.
Natürliche Flüsse bieten außerdem eine große Vielfalt an Lebensräumen. Eine reiche Flora und Fauna fördert wiederum nicht nur das Wachstum von Mikroorganismen, sondern trägt zur Stabilisierung des ökologischen Gleichgewichts bei. Kies- und Sandböden wirken wie natürliche Filter und binden Schmutzpartikel aus dem Wasser. Ufer- und Wasserpflanzen natürlicher Flüsse nehmen überschüssige Nährstoffe wie Nitrat und Phosphat auf, die sonst das Algenwachstum fördern und zu einer Eutrophierung führen können. „Nebenbei entsteht in der urbanen Nachbarschaft für die Bürgerinnen und Bürger ein Naherholungsgebiet mit interessanten und vielfältigen terrestrischen wie aquatischen Pflanzen und Tieren“, so Kramer. Pflanzen stabilisieren außerdem die Ufer und reduzieren Erosion. Mäandernde Flüsse mit natürlichen Überflutungsflächen helfen zudem Hochwasser und Trockenperioden auszugleichen.
All diese Vorteile eines gesunden, natürlichen Bachlaufes hat jetzt auch der Gievenbach zurück: Über eine Länge von 350 Metern wurde der Fluss auf Höhe des Regenrückhaltebeckens renaturiert. Hier darf er sich wieder frei in Mäandern schlängeln, an seinem Ufer wachsen Sträuche und Bäume und die Wasserqualität wird immer besser. Langfristig wird das auch dem Aasee zugutekommen, in den der Gievenbach mündet und der unter hohen Phosphor- und niedrigen Sauerstoffgehalten leidet. „Jede Maßnahme, die dazu führt, den See mit möglichst nährstoffarmen Wassernachschub zu versorgen, steigert die Widerstandskraft des Sees gegenüber Extremwetterlagen und trägt zu dessen Gesundheit bei“, erklärt Kramer. „Zu solchen Maßnahmen tragen auch Gewässerrenaturierungen und wasserbewusste Quartiersentwicklungen im Einzugsgebiet wie im Oxford-Quartier bei.“
Vorbildcharakter
Mit dem zukunftsweisenden Wasserkreislaufkonzept setzt das Oxford-Quartier neue Maßstäbe im Städtebau. Deshalb wurde die Anlage des Systems durch die NRW-Landesregierung mit Mitteln der europäischen Union gefördert. Die Stadt Münster hatte sich im Projektaufruf KommunalerKlimaschutz.NRW mit dem Teilprojekt „Wassersensible Stadtentwicklung Oxford-Quartier“ innerhalb ihrer Strategie „Nachhaltig wachsen: Münster aktiv klimagerecht gestalten“ durchgesetzt und aus dem europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) und Mitteln des Landes NRW Fördermittel zur Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen erhalten.
„Erstmalig für Münster wurde bei dem Wasserkonzept ein besonderes Augenmerk auf eine natürliche Verdunstung gelegt“, erläutert Kramer die Maßnahme. „Das Quartier wird bezüglich der Regenwasserbewirtschaftung eine Impulsfunktion zur nachhaltigen Stadtentwicklung für zukünftige Projekte darstellen.“ Der Förderzweck wurde bereits Anfang 2024 erreicht; die Regenrinnen und Mulden, die mit dem Ausbau der noch ausstehenden Baufelder und Straßen dazukommen, werden in den kommenden Jahren bis zur Fertigstellung des Quartiers an dieses System angeschlossen.
Verdunstung über Regenmulden und Regenrückhaltebecken, entsiegelte Flächen, Parks und Grünanlagen, grüne Dächer im Quartier sowie natürliche Flüsse mit natürlichen Auen und Überschwemmungsflächen speichern Regenwasser, reduzieren Abflussmengen und verbessern das Mikroklima. Das erfordert eine ganzheitliche, blau-grüne Planung, die bestenfalls von Anfang an in die Quartiersentwicklung integriert ist. Das Oxford-Quartier macht es vor: Hier treffen gute Voraussetzungen wie ein großer Baumbestand auf einen Masterplan, der auf eine gute Mischung setzt – an Wohnformen aber auch zwischen Natur und Bebauung.