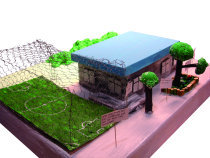Fortschreibung der Klimaanpassungsstrategie
Handlungsfelder Gebäude, Stadtentwicklung und Raumplanung
Das Bundeskabinett hat am 11. Dezember 2024 die fortgeschriebene Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) beschlossen. Damit wurde die Strategie grundlegend weiterentwickelt und in sieben Clustern erstmalig messbare Ziele und Maßnahmen für mehr Vorsorge und Resilienz benannt. Diese Ziele und Maßnahmen werden alle vier Jahre geprüft und, sofern erforderlich, weiterentwickelt. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat für die Fortschreibung die Inhalte der drei Handlungsfelder Raumplanung, Stadtentwicklung und Gebäude sowie den Themenabschnitt Welterbe im übergreifenden Cluster erarbeitet. In einem breit angelegten Prozess wurden die Fachöffentlichkeit und Wissenschaft eng eingebunden und die Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Nachfolgend werden die Inhalte der Strategie in den benannten Handlungsfeldern kurz vorgestellt.
Ziele und Maßnahmen im Handlungsfeld Gebäude
Stärker werdende und häufiger auftretende Extremwettereignisse können zu Schäden an Gebäuden und Liegenschaften führen und bergen dadurch stets erhebliche finanzielle Risiken. Darüber hinaus können diese für Gebäudenutzende zu Beeinträchtigungen der Aufenthaltsqualität bis hin zu Gesundheitsgefahren führen. Insbesondere vulnerable Gruppen, wie Kinder oder ältere Personen, sind durch die Ausprägungen des Klimawandels gefährdet. Als Folgen sind bereits heute vor allem steigende Temperaturen im Sommer und die Zunahme von Starkregenereignissen sowie ein steigendes Risiko von örtlichen Überflutungen festzustellen. Zukünftig ist – je nach Ausmaß der Erderwärmung – mit einer weiteren Zunahme von Extremwetterereignissen zu rechnen. Sowohl beim Neubau wie auch bei den bestehenden Gebäuden ist es erforderlich, den damit verbundenen Auswirkungen präventiv entgegenzuwirken. Über städtebautechnische Lösungen hinaus leisten daher auch standortbezogene bautechnisch vorsorgende Lösungsansätze einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Resilienz von Gebäuden und Liegenschaften.
Ohne die Planungshoheit der Kommunen oder die Zuständigkeit der Länder einzugrenzen, setzt das BMWSB u. a. auf die Verstetigung der Forschung zu technischen und zu rechtlichen Aspekten des klimaangepassten Bauens. Damit können technische Entwicklungen vorangetrieben, deren Verbreitung gefördert und mögliche Hemmnisse in rechtlichen Vorgaben (z. B. BauGB u. a.) und technischen Vorschriften (z. B. DIN-Normen u. a.) identifiziert und beseitigt werden. Bauliche Anpassungsmaßnahmen bei Gebäuden und Liegenschaften sollten mit Mehrfachnutzen und Multifunktion (z. B. Synergieverknüpfung von Klimaschutz und -anpassung) gedacht werden. Dies gilt auch für die Verbindung mit dem Quartier und der Stadtentwicklung. Das BMWSB legt Wert darauf, dass die Erhöhung der Resilienz gegen die Ausprägungen des Klimawandels in sorgfältiger Abwägung mit anderen baupolitischen Zielen, wie der Baukostenbegrenzung, erfolgt.
Ziel ist es, die Sicherheit und die Steigerung der Resilienz von Gebäuden und Liegenschaften gegen die Auswirkungen des Klimawandels erfolgreich umzusetzen. Dafür bedarf es der Einbindung aller Akteurinnen und Akteure, Eigentümerinnen und Eigentümer, der Betreibenden, Planenden und Ausführenden des Bauwesens, sowie der Hersteller von Bauprodukten und der Versicherungsbranche.
Ziele und Maßnahmen im Handlungsfeld Stadtentwicklung
Städte sind besonders anfällig gegenüber den Folgen des Klimawandels. Auswirkungen der zunehmenden Hitze, Trockenheit und Starkregen durch Bebauung und Versiegelung verstärken sich hier. Im bebauten und versiegelten Siedlungsraum ist das Gesundheitsrisiko durch Hitze und „tropische Nächte“ stark erhöht. Gegenüber einer unbebauten Landschaft ist zudem der naturnahe Wasserkreislauf aus Oberflächenabfluss, Versickerung und Verdunstung deutlich verändert. Dies geht mit einem höheren Risiko vor Schäden durch Starkregen und Trockenheit einher.
Der Anspruch des BMWSB im Handlungsfeld Stadtentwicklung ist es, sich bei der Entwicklung der Ziele auf die wesentlichen Risiken und Stellschrauben der Klimaanpassung durch Stadtentwicklung zu konzentrieren. Gleichzeitig sollen Synergien zur Steigerung der Lebensqualität erschlossen werden. Das Handlungsfeld benennt daher folgende zwei Ziele:
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Stadtgebieten, die besondere stadtklimatische Defizite und zugleich einen hohen Anteil vulnerabler Bevölkerungsgruppen aufweisen.
Um diese Ziele zu erreichen, soll der gesetzliche Rahmen gestärkt sowie Förderprogramme genutzt und weiterentwickelt werden. So sollen die Transformationserfordernisse der wassersensiblen Stadtentwicklung und Hitzevorsorge gezielt unterstützt werden. In der Forschung sollen Indikatoren, Berechnungsmethoden und Datengrundlagen zur Messung der Zielerreichung in der Klimaanpassung weiterentwickelt werden. In Modellprojekten werden innovative und übertragbare Handlungsansätze erprobt.
Ziele und Maßnahmen im Handlungsfeld Raumplanung
Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel sind zentrale Aufgaben der Raumordnungsplanung auf Ebene von Bund, Ländern und Regionen.
Analysen zeigen[1], dass viele Raumordnungspläne erst in Ansätzen die multidimensionalen Herausforderungen des Klimawandels thematisieren. Überwiegend werden entsprechende Festlegungen noch nicht von der konkreten Betroffenheit der Regionen bzw. Länder vom Klimawandel abgeleitet. Außerdem spielt der Schutzbedarf von Raumnutzungen und Raumfunktionen bei der Bestimmung der Festlegungen mit Bezug zum Klimawandel bisher kaum eine Rolle.
Um die Planungsakteure stärker zu sensibilisieren und zu motivieren, legt die Deutsche Klimaanpassungsstrategie 2024 nachfolgende zwei Ziele fest:
Ziel des Klimaanpassung-Monitorings für Raumordnungspläne ist es, zunächst für ausgewählte Handlungsfelder zusammenfassend zu prüfen und darzustellen, wie sich Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Bewältigung der Herausforderung des Klimawandels widerspiegeln und wie sich diese über die Zeit entwickeln. Die vier Handlungsfelder sind:
1. Umgang mit Wasserknappheit
2. Vorbeugender Hochwasserschutz in Flussgebieten einschließlich CO₂-Senken
3. Schutz vor Hitzefolgen in Siedlungsbereichen
4. Verschiebung der Lebensräume von Tieren und Pflanzen einschließlich Biotopflächenverbund.
Um den Stand und den Fortschritt der Raumordnungsplanung im Hinblick auf die Aktualisierung der Raumordnungspläne im Politikfeld „Anpassung an den Klimawandel“ zukünftig besser abbilden und bewerten zu können, soll ein speziell auf den Klimawandel ausgerichtetes Monitoring in den bestehenden Raumordnungsplan-Monitor (ROPLAMO) des BBSR integriert werden.
In einer laufenden Studie wird hierzu ein Monitoring-Ansatz entwickelt und getestet.
Zur Umsetzung des zweiten Ziels ist ein Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) „Klimawandelgerechter Regionalplan 2.0 (KlimReg 2.0)“ in Vorbereitung.
Im Mittelpunkt steht dabei, die Raumplanung auf Landes- und regionaler Ebene methodisch und inhaltlich stärker für die Notwendigkeiten und planerischen Möglichkeiten der Klimaanpassung zu sensibilisieren und zu unterstützen.
Ganzheitliche Perspektive
Neben diesen Handlungsfeldern hat das BMWSB auch die Schnittstellen zwischen den Maßstabsebenen im Blick. Hier geht es bspw. um das Zusammenwirken der Kaltluftentstehungsgebiete außerhalb der Städte mit den stadt(regionalen) Freiraumverbundsystemen oder den Einfluss von Begrünung im Quartier und Wohnumfeld auf die einzelnen Gebäude. Im Themenabschnitt Welterbe im Cluster Übergreifendes steht das Ziel der Erarbeitung von Klimaanpassungskonzepten für Welterbestätten im Vordergrund. Die Umsetzung der Deutschen Klimaanpassungsstrategie erfordert ein ganzheitliches Vorgehen und geschieht in diesem Sinne auch in enger Abstimmung mit den beteiligten Ressorts.
[1] Abschlussbericht „Klimawandel und Energiewende gestalten – Vorbereitungsstudie zum Raumordnungsbericht 2024“; BBSR; Bonn, Oktober 2023